Angelsächsische Münzmeister
 ie
schon im vorhergehenden Kapitel thematisiert, ist unklar ob es
sich beim Stempelschneider und beim Münzmeister um ein- und dieselbe
Person handelte oder nicht. Da in vielen Quellen nur immer die Rede
von einem «Münzmeister» ist, werde ich ebenfalls diesen
Ausdruck verwenden obwohl vielleicht «Stempelschneider»
in manchen Zusammenhängen korrekter wäre.
ie
schon im vorhergehenden Kapitel thematisiert, ist unklar ob es
sich beim Stempelschneider und beim Münzmeister um ein- und dieselbe
Person handelte oder nicht. Da in vielen Quellen nur immer die Rede
von einem «Münzmeister» ist, werde ich ebenfalls diesen
Ausdruck verwenden obwohl vielleicht «Stempelschneider»
in manchen Zusammenhängen korrekter wäre.
Die Namen der Münzmeister welche man auf den Inschriften der Münzen
wiederfindet sind nicht immer leicht zu entziffern. Die Werkzeuge
zur Gravierung der Buchstaben in den Stempel bestanden wohl aus einem
geraden Meissel mit sehr kleinem Massstab sowie eines ebenfalls kleinen
Hohlmeissels.
Der erstere wurde für die geraden Striche der Buchstaben verwendet,
der zweite für die Rundungen. Um also ein
« »
zu gravieren benötigte der Münzmeister also 4-mal den geraden Meissel
und für ein «
»
zu gravieren benötigte der Münzmeister also 4-mal den geraden Meissel
und für ein « » folglich
2-mal den geraden und einmal den Hohlmeissel.
» folglich
2-mal den geraden und einmal den Hohlmeissel.
Es ist leider häufig vorgekommen, das ein Mann - welcher wenig von
Buchstaben versteht - einen Strich vergass, versetzt einschlug oder
gar das falsche Werkzeug erwischte. So wurde z.B aus einem
« » ein
«
» ein
« » und nur ein leichter
Schlag machte aus einem «
» und nur ein leichter
Schlag machte aus einem « »
ein «
»
ein « ». Das kleinste
Zittern mit der Hand konnte aus einem
«
». Das kleinste
Zittern mit der Hand konnte aus einem
« » ein
«
» ein
« » machen oder aus einem
«
» machen oder aus einem
« » ein
«
» ein
« ».
«
».
« » und
«
» und
« » wurden ständig
vertauscht sowie auch «
» wurden ständig
vertauscht sowie auch « »
und «
»
und « » - noch viel
häufiger aber «
» - noch viel
häufiger aber « » und
«
» und
« ». Im letzteren Beispiel
liegt noch ein 2. Fehlerpotential, nämlich im Buchstaben
«
». Im letzteren Beispiel
liegt noch ein 2. Fehlerpotential, nämlich im Buchstaben
« » (=N) der Runenschrift
und dem römischen «N». Diese Fehler der Graveure geben dem
Münzenkenner - welcher vertraut mit Inschriften ist - ein bestimmtes
Flair für die richtigen Namen, obschon das Spektrum der falsch
geschriebenen Namen sehr vielfältig sein kann.
» (=N) der Runenschrift
und dem römischen «N». Diese Fehler der Graveure geben dem
Münzenkenner - welcher vertraut mit Inschriften ist - ein bestimmtes
Flair für die richtigen Namen, obschon das Spektrum der falsch
geschriebenen Namen sehr vielfältig sein kann.
Falls beispielsweise auf mehreren Fundmünzen aus einer Regierungszeit
eines Königs (oder aufeinander folgenden Königen) immer der Name
Earduulf vorgefunden wird und nur auf einem oder zwei Stücken
der Name Eaduulf, ist es wahrscheinlicher, das der Graveur das
« » ausgelassen hat, als
das ein neuer Münzmeister diese Münzen signiert hat. Mit diesen
Annahmen können die Numismatiker zwar falsch liegen aber mit jeder neu
registrierten Fundmünze wird die Wahrscheinlichkeit für einen
eingeschlichenen Fehler kleiner.
» ausgelassen hat, als
das ein neuer Münzmeister diese Münzen signiert hat. Mit diesen
Annahmen können die Numismatiker zwar falsch liegen aber mit jeder neu
registrierten Fundmünze wird die Wahrscheinlichkeit für einen
eingeschlichenen Fehler kleiner.
Die Namen der Münzmeister sind typisch angelsächsisch. Sie sind entweder
einsilbig, wie z.B. Brid, Dun(n), Man(n) oder mehrsilbig mit
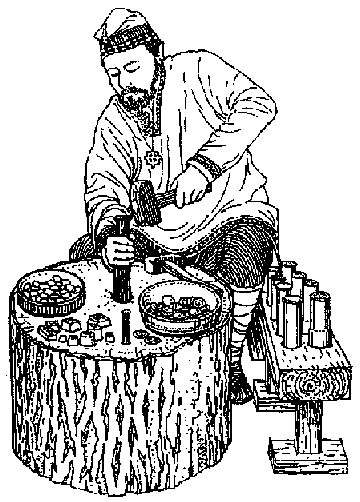 endendem «
endendem « » wie Bosa, Buda, Diga,
Ella, Hussa, Ifa, Lulla, Oba, Tata, Tocga, Tuma, Wina…
» wie Bosa, Buda, Diga,
Ella, Hussa, Ifa, Lulla, Oba, Tata, Tocga, Tuma, Wina…
Weiterhin auch kommen auch Namen vor mit typisch altenglischen Endungen
wie -beald (bald), -berht (bryht), -brord, -el, -frið (ferð),
-gar, -geard, -hæd, -heah, -heard (hard), -helm, -here, -hun,
-ing, -lac, -laf, -mod, -mund, -noð, -red, -ric, -sige, -stan,
-wald (weald), -weard, -wig, -wine, -wulf (ulf) und seltenere Endungen
wie -hyse oder -uc. Ohne Zweifel kommen auch eigentümliche
Namen vor, aber im Vergleich dazu sehr selten. Während der Regierungszeit
von Ælfred finden sich Münzmeister namens Samson, Simon
und einem Stefanus.
Diese Namen deuten darauf hin, das sie keine Engländer waren.
Zu dieser Zeit gab es jedoch auch Ausgaben der Wikinger und es finden
sich darunter fränkische wie auch skandinavische Namen.
Es ist aufgrund der oben genannten Schreibfehler nicht immer ganz einfach,
englische Namen von fränkischen zu unterscheiden. Vorsilben wie
Arn-, Nor-, Od-, Ulf- und Endungen wie -cytel, -fara, -fugel
und -leda sind aber sehr charakteristisch.
Über die Stellung der damaligen Münzmeister ist leider relativ wenig
bekannt. Auch die Inschrift auf der Rückseite wirft kein Licht auf die
Stellung der Münzmeisters. Auf der Rückseite befindet sich wie oben
mehrfach beschrieben nur der Name des Münzmeisters, anschliessend ein
Teil des Wortes Monetarius oder auch nur M gefolgt von dem
Wort ON oder O und schliesslich der Prägeort.
Folgendes Beispiel möge hier dienen:













 (Ælfric Monetarius on Huntingdon)
(Ælfric Monetarius on Huntingdon)
Münzmeister von 1572-1869
 ünzmeister
der Prägestätten der englischen Regierung
zu sein war ein sehr wichtiger Job zwischen dem 16.
und 19. Jahrhundert. Die Anstellung war sogar bis 1699
auf Lebzeiten!
ünzmeister
der Prägestätten der englischen Regierung
zu sein war ein sehr wichtiger Job zwischen dem 16.
und 19. Jahrhundert. Die Anstellung war sogar bis 1699
auf Lebzeiten!
Liste der Münzmeister
- John Lonyson 1571-1582
- Sir Richard Martin 1582-1599
- Sir Richard Martin and Richard Martin 1599-1616
- Sir Richard Martin 1616-1617
- Sir Edward Villiers 1617-1623
- Sir Randal Cranfield 1623-1626
- Sir Robert Harley 1626-1635
- Im Amt von 1635-1643: Sir Ralph Freeman; Sir Thomas Aylesbury
- Sir Robert Harley 1643-1649
- Aaron Guerdon 1649-1653
- Sir Ralph Freeman 1660-1662
- Sir Ralph Freeman and Henry Slingsby 1662-1667
- Henry Slingsby 1667-1680
- Im Amt von 1680-1684: Sir John Buckworth; Charles Duncombe; James Hoare
- Thomas Neale 1686-1699
- Isaac Newton 1700-1727
- John Conduitt 1727-1737
- Richard Arundell 1737-1745
- William Chetwynd, 3rd Viscount Chetwynd 1745-1769
- Charles Sloane Cadogan, 3rd Lord Cadogan 1769-1784
- Thomas Howard, 3rd Earl of Effingham 1784-1789
- Philip Stanhope, 5th Earl of Chesterfield 1789-1790
- George Townshend, 1st Earl of Leicester 1790-1794
- Sir George Yonge 1794-1799
- Robert Banks Jenkinson, Lord Hawkesbury 1799-1801
- Charles George Perceval, 1st Lord Arden 1801-1802
- John Smyth 1802-1804
- Henry Bathurst, 3rd Earl Bathurst 1804-1806
- Lord Charles Spencer 1806
- Charles Bathurst 1806-1807
- Henry Bathurst, 3rd Earl Bathurst 1807-1812
- Richard Le Poer Trench, 2nd Earl of Clancarty 1812-1814
- William Wellesley Pole, Lord Maryborough 1814-1823
- George Tierney 1827-1828
- John Charles Herries 1828-1830
- George Eden, 2nd Lord Auckland 1830-1834
- James Abercromby 1834-1835
- Alexander Baring 1835
- Henry Labouchere 1835-1841
- William Ewart Gladstone 1841-1845
- Sir George Clerk 1845-1846
- Richard Lalor Sheil 1846-1850
- Sir John Frederick William Herschel 1850-1855
- Thomas Graham 1855-1869
 ie
schon im vorhergehenden Kapitel thematisiert, ist unklar ob es
sich beim Stempelschneider und beim Münzmeister um ein- und dieselbe
Person handelte oder nicht. Da in vielen Quellen nur immer die Rede
von einem «Münzmeister» ist, werde ich ebenfalls diesen
Ausdruck verwenden obwohl vielleicht «Stempelschneider»
in manchen Zusammenhängen korrekter wäre.
ie
schon im vorhergehenden Kapitel thematisiert, ist unklar ob es
sich beim Stempelschneider und beim Münzmeister um ein- und dieselbe
Person handelte oder nicht. Da in vielen Quellen nur immer die Rede
von einem «Münzmeister» ist, werde ich ebenfalls diesen
Ausdruck verwenden obwohl vielleicht «Stempelschneider»
in manchen Zusammenhängen korrekter wäre. »
zu gravieren benötigte der Münzmeister also 4-mal den geraden Meissel
und für ein «
»
zu gravieren benötigte der Münzmeister also 4-mal den geraden Meissel
und für ein « » folglich
2-mal den geraden und einmal den Hohlmeissel.
» folglich
2-mal den geraden und einmal den Hohlmeissel.
 » ein
«
» ein
« » und nur ein leichter
Schlag machte aus einem «
» und nur ein leichter
Schlag machte aus einem « »
ein «
»
ein « ». Das kleinste
Zittern mit der Hand konnte aus einem
«
». Das kleinste
Zittern mit der Hand konnte aus einem
« » machen oder aus einem
«
» machen oder aus einem
« ».
«
».
« » und
«
» und
« » wurden ständig
vertauscht sowie auch «
» wurden ständig
vertauscht sowie auch « » - noch viel
häufiger aber «
» - noch viel
häufiger aber « ». Im letzteren Beispiel
liegt noch ein 2. Fehlerpotential, nämlich im Buchstaben
«
». Im letzteren Beispiel
liegt noch ein 2. Fehlerpotential, nämlich im Buchstaben
«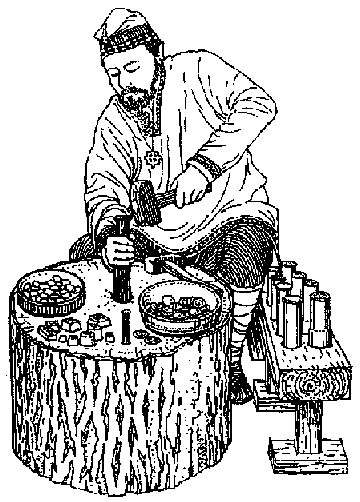






 (Ælfric Monetarius on Huntingdon)
(Ælfric Monetarius on Huntingdon)
 ünzmeister
der Prägestätten der englischen Regierung
zu sein war ein sehr wichtiger Job zwischen dem 16.
und 19. Jahrhundert. Die Anstellung war sogar bis 1699
auf Lebzeiten!
ünzmeister
der Prägestätten der englischen Regierung
zu sein war ein sehr wichtiger Job zwischen dem 16.
und 19. Jahrhundert. Die Anstellung war sogar bis 1699
auf Lebzeiten!